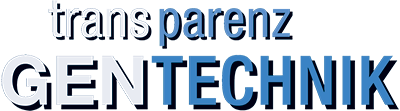CRISPR-Pflanzen und Öko-Landwirtschaft: Wächst da was zusammen?
(03.05.2017) Mit den neuen Genome Editing-Verfahren ist einiges in Bewegung gekommen. In der Pflanzenzüchtung scheinen nun Ziele erreichbar, die mit denen des ökologischen Landbaus übereinstimmen: Etwa Low-Input-Pflanzen, die weniger Ressourcen benötigen und zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft beitragen. Bisher sind die neuen Verfahren in der Öko-Branche offiziell tabu, da sie der verbotenen Gentechnik zugerechnet werden. Doch deren schlechtes Image könnte bald zum Bumerang werden.
In der Öko-Landwirtschaft sind gentechnisch veränderte (gv-)Pflanzen strikt verboten. Dies ist in den Standards der internationalen Bio-Dachorganisation (IFOAM) klar festgelegt; in vielen Ländern – auch in der EU – gelten entsprechende Gesetze. Die Bio-Branche orientiert sich dabei an den seit 25 Jahren nahezu unveränderten gesetzlichen Definitionen: Was danach als GVO eingestuft wird, ist nicht erlaubt – andere wissenschaftsbasierte Verfahren wie Mutationszüchtung oder Smart Breeding, die unterhalb dieser Schwelle bleiben, schon.

Zum Beispiel Kartoffeln, Kraut- und Knollenfäule. Lösung: Übertragung mehrerer Resistenzgene aus Wildkartoffeln, dadurch langanhaltende Resistenz. In der konventionellen Landwirtschaft kann dann auf einen Großteil der Fungizide (80% weniger) verzichtet werden, der Ökolandbau wäre nicht mehr auf umweltschädliche Kupferpräparate angewiesen. Es wird kein artfremdes Genmaterial übertragen (Cisgenetik), aber die Kartoffeln gelten als GVO und sind daher im Ökolandbau verboten.

Zum Beispiel: Banane, Panama- und andere Krankheiten. Das Einkreuzen von Resistenzgenen aus Wild- in Kulturbananen ist schwierig bis aussichtslos, da Bananen vegetativ vermehrt werden. Mit CRISPR und anderen neuen Verfahren ist es grundsätzlich möglich resistente Kulturbananen zu züchten, die auch unter Öko-Standards angebaut werden können. Derzeit ist das durch die Einstufung als GVO ausgeschlossen.
Doch nun geraten die bisher so klaren Fronten ins Wanken. Grund dafür sind die neuen Genome Editing-Verfahren wie CRISPR/Cas, mit denen einzelne DNA-Bausteine punktgenau „umgeschrieben“ werden können. Zwar werden die molekularen Editing-Werkzeuge mit gentechnischen Verfahren in eine Pflanzenzelle eingeschleust. Doch anders als bei der klassischen Gentechnik bleiben diese Werkzeuge nicht dauerhaft im Erbgut der Pflanzen, sondern bewirken eine punktgenaue Mutation an einer ganz bestimmten Stelle in einem Gen. In den Nachkommen der Pflanzen, die aus diesem Prozess hervorgehen – also dem Saat- oder Pflanzgut – ist kein fremdes Erbmaterial mehr vorhanden. Die herbeigeführten Änderungen sind von spontanen, natürlichen Mutationen nicht unterscheidbar – und damit auch nicht nachweisbar.
Trotz der ungleich höheren Präzision – und damit auch weniger Zufälligkeiten – lehnen Öko-Verbände und die ihnen nahe stehende Parteien mit Genome Editing gezüchtete Pflanzen vehement ab - mit den gleichen Argumenten, die sie seit 25 Jahren gegen die Gentechnik vorbringen. Mehr noch: Es handele sich um „versteckte Gentechnik“, die unerkannt den Verbrauchern untergeschoben werden soll – nur ein raffinierter Trick, die gesellschaftliche Ablehnung zu umgehen.
Doch ganz so eindeutig wie in den offiziellen Erklärungen verlaufen die Fronten nicht mehr. Während die „alte“ Gentechnik meist Pflanzen hervorbrachte, die wie etwa bei der Herbizidresistenz, auch: Herbizidtoleranz mit den Zielen und Grundsätzen des Öko-Landbaus kaum vereinbar waren, ist das beim Genome Editing nicht so. Die neue Methode eröffnet „für Landwirte – auch für Öko-Landwirte – viele Chancen,“ so Prof. Urs Niggli, wissenschaftlicher Direktor des FIBL (Forschungsinstitut für biologischen Landbau) in einem viel beachteten Interview mit dem Greenpeace Magazin. „Es könnten Pflanzen gezüchtet werden, die sich besser an schwierige Umweltbedingungen anpassen – etwa Trockenheit, Bodennässe oder Versalzung. Die Feinwurzelarchitektur könnte verbessert werden, damit die Wurzeln mehr Nährstoffe wie Phosphor oder Stickstoff aus dem Boden aufnehmen. Auch die Toleranz oder Resistenz gegenüber Krankheiten und Schaderregern sowie Lagerungsfähigkeit und Qualität von Lebens- und Futtermitteln könnten verbessert werden.“
Pflanzen, die weniger Ressourcen benötigen und gute Erträge liefern, besser – da wirksamer und ohne synthetische Pflanzenschutzmittel - mit Krankheiten und Schädlingen fertig werden, und mit den Bedingungen des Klimawandels zurecht kommen – solche Ziele gelten gleichermaßen für die ökologische wie konventionelle Landwirtschaft.
Werden in Zukunft mit den neuen Verfahren gezüchtete Pflanzen als politisch unerwünschte GVO eingestuft oder gar deren Anbau verboten, blieben für die konventionelle Landwirtschaft wirksame Möglichkeiten versperrt, „ihre ökologischen Probleme“ zu lösen und „ernsthafte Schritte in Richtung echter Nachhaltigkeit“ (Niggli) einzuleiten.
Doch auch die Öko-Landwirtschaft ist längst nicht perfekt. Nicht nur, dass sie mehr Flächen benötigt, um die gleichen Erträge zu erzielen. Bei einigen Kulturarten gibt es gegen bestimmte Schädlinge oder Krankheitserreger keine oder nur extrem aufwändige züchterische Lösungen. Bei Kartoffeln und Wein müssen problematische Kupferpräparate gegen Pilzkrankheiten gespritzt werden, die sich im Boden anreichern – und bei starkem Befall dennoch nur unzureichend vor Verlusten schützen. Neue molekularbiologische Verfahren könnten auch hier eine Alternative zur derzeitigen Praxis sein. Doch solange sie verboten bleiben, können Öko-Landwirte das mit CRISPR und anderen Genome Editing-Verfahren erschließbare Nachhaltigkeitspotenzial nicht für sich nutzen.
„I have a dream“ beginnt denn auch ein Artikel des Essener Zellbiologen Gerhart Ryffel im Wissenschaftsjournal Sustainability. Aus seiner Sicht müsse der Öko-Landbau sich gegenüber neuen Verfahren öffnen, um die eigene Nachhaltigkeitsbilanz weiter zu steigern. Zwar plädiert Ryffel dafür, auch damit gezüchtete Pflanzen als GVO anzusehen, zugleich aber solle die internationale Bio-Wirtschaft Genome Editing und ähnliche Verfahren nicht mehr grundsätzlich verbieten. Ryffel schlägt Kriterien vor, unter denen „neue“ gv-Pflanzen im organischen Landbau toleriert werden sollten:
- In der gv-Pflanze darf keine DNA aus nicht kreuzungsfähigen Arten vorhanden sein. Die Abwesenheit solcher DNA-Bausteine ist durch Sequenzanalyse zu belegen.
- Die gv-Pflanzen müssen unter Bedingungen des ökologischen Landbaus kultivierbar sein, insbesondere keine synthetisch-chemischen Stoffe benötigen wie etwa Herbizide oder Düngemittel.
- Die gv-Pflanze muss frei zugänglich sein. Den Landwirten sollte erlaubt sein, sie zu vermehren und weiterzuzüchten.
Anhand dieser Kriterien, so Ryffel, könne der Bio-Landbau bestimmte gv-Pflanzen in sein System integrieren, ohne damit die eigenen Grundsätze – Gesundheit, Ökologie, Gerechtigkeit und Vorsorge – zu verletzen. Beispiele für „gute“ ökologische Gentechnik sind für Ryffel etwa phytophthora-resistente Kartoffeln sowie Bananen, die gegen die neue Variante der Panamakrankheit oder bakterielle Erreger resistent sind (siehe Kasten).
Aktuell haben die Vorschläge Ryffels wohl kaum Realisierungschancen. Die erforderlichen politischen Mehrheiten sind nicht in Sicht. Die Gentechnik ist zu stark moralisch aufgeladen – und die Bio-Branche lebt bisher gut vom Negativ-Image der Gentechnik. Es wird gebraucht, damit die eigenen Produkte sich umso deutlicher davon abgrenzen können.
Jetzt zeigt sich die Kehrseite der jahrelangen Anti-Gentechnik-Kampagnen: Je mehr sie pauschal als gefährlich, allein profitorientiert oder als eine Verletzung der „Integrität“ der Pflanze dargestellt wurde, um so schwieriger wird es, die neuen Verfahren nicht als etwa Böses, sondern als Chance auch für die Öko-Landwirtschaft darzustellen.
Diskussion / Kommentare
 Kommentare werden geladen…
Kommentare werden geladen…
Themen
Im Web
- Öko-Forscher: „Ich bin gegen eine generelle Verteufelung der neuen Gentechnik“; Interview mit Urs Niggli, Greenpeace Magazin 24, Feb2017
- „CRISPR hat großes Potenzial“. Interview mit Urs Niggli (FIBL, Forschungsinstitut für biologischen Landbau), taz 06.04.2016
- Gerhart U. Ryffel, I Have a Dream: Organic Movements Include Gene Manipulation to Improve Sustainable Farming; Sustainability 2017
- James Dale et al., Modifying Bananas: From Transgenics to Organics?, Sustainability 2017