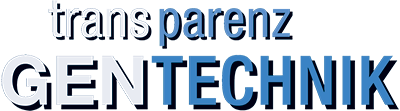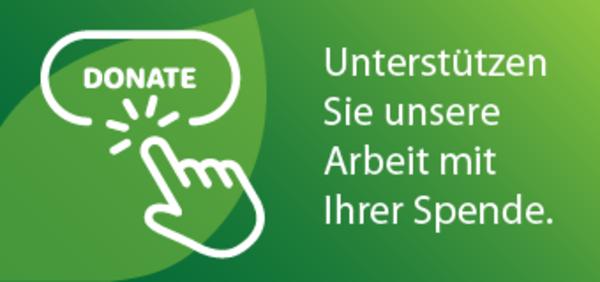Explodierende Befallszahlen: Der Maiswurzelbohrer ist nicht aufzuhalten
Seit er in den 1990er Jahren aus den USA eingeschleppt wurde, hat sich der Maiswurzelbohrer in Europa längst etabliert. Besondere Vorschriften für den Maisanbau wie etwa Fruchtwechsel konnten den Schädling nicht stoppen. In Deutschland trat der Käfer zunächst vor allem am Oberrhein sowie in Nieder- und Oberbayern auf. Inzwischen hat er sich weiter ausgebreitet und wandert allmählich immer weiter nordwärts. In den letzten Jahren ist die Zahl der Käfer in den Befallsregionen förmlich explodiert.

Sprunghaft angestiegen: Zahl der in den aufgestellten Fallen gefangenen Käfer in Bayern und Baden-Württemberg. Weitere Funde: Nordrhein-Westfalen (2010), Hessen (seit 2011), Rheinland-Pfalz (seit 2012), Sachsen (seit 2013), Thüringen, Brandenburg (seit 2021). Quellen: RP Freiburg, LTZ Augustenberg, ISIP, LfL Bayern, DMK

Die Larven des Käfers fressen an den Wurzeln, dadurch können die Pflanzen weniger Wasser und Nährstoffe aufnehmen und kippen leicht um. - Großes Foto oben: Schäden in der Steiermark 2014.

Die flugfähigen Käfer befallen auch die Kolben.
Fotos: Mihaly Czepo

Ausbreitung des Maiswurzelbohrers in Europa: Mitte der 1990er-Jahre eingeschleppt mit einem Flugzeug aus den USA, breitete sich der Schädling zuerst in Südosteuropa aus.
Karte: Stand 2012; Quelle: Purdue University
2007 ging das erste Exemplar eines Maiswurzelbohrers (Diabrotica virgifera virgifera) in eine der in Bayern und Baden-Württemberg aufgestellten Lockstofffallen (Pheromonfallen). Allein in der Bodenseeregion wurden damals 346 Käfer gefangen.
Wie zuvor schon in anderen europäischen Maisanbauregionen wurden daraufhin auch in Süddeutschland strenge Vorschriften eingeführt mit dem Ziel, den Schädling in den Befallsgebieten auszurotten und seine weitere Verbreitung zu verhindern. In einigen Regionen war das Konzept erfolgreich, in anderen jedoch nicht: So konnten in der Bodenseeregion Befalls- und Sicherheitszonen 2010 aufgehoben werden.
Dagegen sind in der Rheinebene Baden-Württembergs sowie in Ober- und Unterbayern in den letzten Jahren die Zahlen der in den Fallen gefundenen Käfer sprunghaft gestiegen. In Bayern hatten sich die Fangzahlen 2018 gegenüber dem Vorjahr vervierfacht, in Baden-Württemberg nahezu verdoppelt. Seitdem steigen die Zahlen weiter an. Vor allem in Baden-Württemberg finden sich von Jahr zu Jahr mehr Käfer in den Fallen. 2023 waren es dort mit knapp 440.000 so viele Käfer wie noch nie, in 2025 wurden bereits bis August 300.000 gefangen (Stand 25.08.2025).
In den Anfangsjahren war der Maiswurzelbohrer noch ein sogenannter Quarantäneschädling. Damit musste jedes Auftreten gemeldet und strenge Vorschriften zur Befallskontrolle und –eindämmung eingehalten werden. Da die Schutzmaßnahmen letztlich jedoch nicht verhindern konnten, dass sich der Schädling etablierte, wurde der Quarantänestatus 2014 aufgehoben. Die amtliche Überwachung mit Pheromonfallen wird seitdem weiter fortgesetzt, um Landwirte frühzeitig warnen zu können.
Ein chemisches Pflanzenschutzmittel, mit dem der Schädling bekämpft werden könnte, ist in Deutschland nicht zugelassen. Auch Mais-Saatgut, das mit bestimmten Insektizid-Wirkstoffen (Neonicotinoide) gebeizt wurde, ist seit Ende 2013 in der EU nicht mehr erlaubt. Die Verwendung von Insektiziden erwies sich sowieso als nicht nachhaltig, da die Käfer relativ schnell Resistenzen ausbildeten. Die derzeit wirksamste Maßnahme zur Befallseindämmung ist die Einhaltung der Fruchtfolge. Es wird dringend empfohlen, Mais nur in maximal zwei aufeinanderfolgenden Jahren auf derselben Fläche anzubauen. In einigen betroffenen Regionen ist die Fruchtfolgeregelung inzwischen verpflichtend.
Trotz Maßnahmen geht die Zunahme und Ausbreitung der Käfer weiter. Inzwischen wurden auch Maiswurzelbohrer in nördlicheren Bundesländern nachgewiesen. In Brandenburg waren es 2022 bereits 290, in Rheinland-Pfalz 3128 und auch in Sachsen und Thüringen wurden Schädlinge gefunden. In Hessen waren 2024 mit 429 Käfern viermal so viele Tiere in den Fallen wie im Jahr davor. Eine flächendeckende Ausbreitung der Käfer Richtung Norden ist wohl nur eine Frage der Zeit.
Ein Schädling, der nicht aufzuhalten ist. Was tun, wenn es keine zugelassenen Pflanzenschutzmittel gibt?
Die Landwirtschaft ist auf die Entwicklung wirksamer und umweltverträglicher Bekämpfungskonzepte angewiesen. Eine Methode, die in Befallsgebieten in Ungarn und Österreich zunächst vielversprechend schien, ist der Einsatz von Fadenwürmern (Nematoden), die der Mais über seine Wurzeln anlockt. Nematoden sind natürliche Feinde des Wurzelbohrers, sie dringen in die Schädlingslarven ein und sondern ein Bakterium ab, was diese abtötet. Das Bakterium vermehrt sich dann in seinem abgestorbenen Wirt.
Leider war diese biologische Schädlingskontrolle nicht so erfolgreich wie erhofft. Am Max-Planck-Institut (MPI) für chemische Ökologie in Jena fand man heraus warum: Die Käferlarven können giftige Abwehrstoffe, die die Maispflanzen über die Wurzeln abgeben, in einer ungiftigen Form speichern, sie später bei Bedarf aktivieren und gegen die eigenen Feinde einsetzen. Der Schädling wandelt sozusagen die pflanzliche Abwehr zu seinem eigenen Schutz um.
Ein Forschungsteam am MPI in Jena will nun herausfinden, wie der Schädling die Verteidigung der Maispflanzen austrickst, um das eigene Überleben zu sichern. Gesucht wird nach den Genen, die ihn dazu befähigen. Ein mögliches neues Pflanzenschutzkonzept könnte darin bestehen, die entsprechenden Gene stillzulegen und den Mechanismus damit auszuhebeln.
In den USA, Kanada und Brasilien wurde 2015 und 2016 ein neuer Mais (MON87411) zugelassen, der die RNAi-Methode als Mittel gegen den Maiswurzelbohrer nutzt. Der gentechnisch veränderte (gv) Mais bildet RNA-Schnipsel, die genau zu einem bestimmten Gen (snf7) im Erbgut des Maiswurzelbohrers passen und dieses blockieren. Das entsprechende Protein kann nicht mehr gebildet werden und der Schädling stirbt ab. MON87411 wurde verschiedenen bereits zugelassenen gv-Maislinien hinzugefügt. Nachdem die amerikanische Umweltbehörde EPA das RNAi-Konzept in Mais als Insektizid zugelassen hat, ist das Saatgut unter dem Markennamen SmartStax Pro inzwischen auf dem Markt. In der EU ist MON87411 seit Juli 2019 für den Import zugelassen.
Zusätzlich zu dem RNAi-Mechanismus bildet der SmartStax Pro-Mais drei Bt-Proteine, die spezifisch gegen den Maiswurzelbohrer wirken. Die Kombination der verschiedenen Wirksysteme sollen die Ausbildung von Resistenzen verhindern bzw. verzögern. Bt-Mais mit nur einem wirksamen Bt-Protein führte schon nach wenigen Jahren des Anbaus in den USA dazu, dass der Schädling resistent wurde. Daher werden heute bei der Entwicklung neuer Maissorten verschiedene Wirkstoffe und -mechanismen miteinander kombiniert.
Diskussion / Kommentare
 Kommentare werden geladen…
Kommentare werden geladen…
Themen
Im Web
- Maiswurzelbohrer in Mais - Befallserhebungen. ISIP - das Informationssystem für die integrierte Pflanzenproduktion
- Maiswurzelbohrer-Monitoring in Bayern, LfL - Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft
- Verbreitungskarten des Westlichen Maiswurzelbohrers in Baden-Württemberg. Landwirtschaftliches Technologiezentrum (LTZ) Augustenberg
- Regierungspräsidium Gießen - Pflanzenschutzdienst Hessen, Jahresbericht 2024
- Westlicher Maiswurzelbohrer - Erstbefall im Landkreis Bautzen und weitere Informationen zu tierischen Schaderregern 2018, LfULG Sachsen 14.01.2019
- Allgemeinverfügung des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald über Maßnahmen zur Bekämpfung des Maiswurzelbohrers (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte). RP Freiburg, 15.08.2022
- Maisschädling schlägt Mais mit dessen eigenen Waffen (Max-Planck-Institut für chemische Ökologie, idw (27.11.2017)
- DURCHFÜHRUNGSRICHTLINIE 2014/19/EU DER KOMMISSION vom 6. Februar 2014 zur Änderung des Anhangs I der Richtlinie 2000/29/EG des Rates über Maßnahmen zum Schutz der Gemeinschaft gegen die Einschleppung und Ausbreitung von Schadorganismen der Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse
- Diabrotica-Ausbreitung in Österreich, interaktive Karte