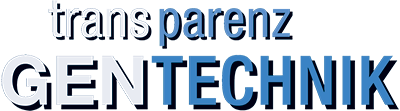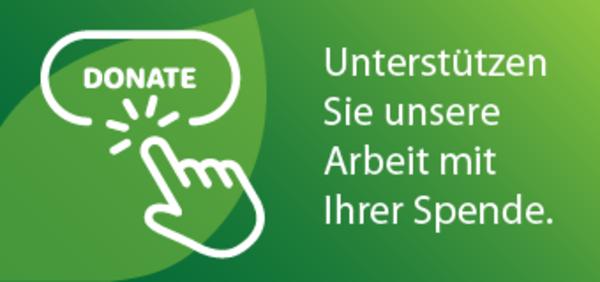Gartenbohne
| Anbau-Zulassung | Brasilien (2011) |
|---|---|
| Anbau | Saatgut soll ab 2015/16 erhältlich sein |
| Forschungsschwerpunkte | Virus- und Pilzresistenz, Herbizidtoleranz |
| Freilandversuche | USA: 2 (2006-2007) Brasilien, Mexiko |
Als Gartenbohne (Phaseolus vulgaris) wird eine Vielzahl von Bohnen in unterschiedlichen Formen und Farben bezeichnet. Die aufrecht wachsende Buschbohne wird vor allem im Feldanbau kultiviert, die rankende Stangenbohne (auch: grüne Bohne) in Gärten und Gewächshäusern.
Die Gartenbohne stammt ursprünglich aus den Hochflächen Mittel- und Südamerikas. Im 16. Jahrhundert brachten die Spanier sie nach Europa, aber ähnlich wie Kartoffeln und Tomaten wurden sie in Europa erst viel später als Nahrungsmittel akzeptiert. Die Gartenbohne verdrängte nach ihrer Einführung in Europa die bis dahin genutzten Acker- und Kuhbohnen.

Pintobohnen - eine Sorte der Art Phaseolus vulgaris - sind ein traditionelles Grundnahrungsmittel in Brasilien. Um den Bedarf zu decken, müssen Bohnen aus Argentinien, Bolivien und China eingeführt werden.
Foto: iStockphoto
Heute wachsen Gartenbohnen in allen Erdteilen, die Züchter haben sie an unterschiedliche Klimazonen und Witterungsbedingungen angepasst. In Mittelamerika und Afrika nutzen Kleinbauern die Gartenbohnen oft in Mischkulturen zusammen mit Mais oder Kaffee.
Führendes Erzeugerland für Bohnen ist Brasilien mit einer Jahresproduktion von etwa drei Millionen Tonnen.
Bohnen haben wie andere Hülsenfrüchte (Linse, Erbse, Sojabohne) einen hohen Gehalt an Proteinen. In vielen Ländern Mittel- und Südamerikas sind sie Hauptbestandteil der Nahrung. Vor dem Verzehr müssen Bohnen gekocht werden, um giftige Eiweißverbindungen abzubauen.
Von der Gartenbohne werden die nicht voll ausgereiften Hülsenfrüchte und die Blätter als Lebensmittel verwendet. Die unreifen Hülsenfrüchte werden gekocht als Gemüse oder Salat verzehrt bzw. zu Konserven- und Tiefkühlgemüse verarbeitet. Die reifen Samen werden für Suppen und Pürees verwendet. Die Blätter lassen sich getrocknet oder gekocht als Küchengewürz nutzen, die Hülsen zu Arzneien und Tees verarbeiten.
Gentechnik: Ziele bei Forschung und Entwicklung
Anbaueigenschaften
- Virusresistenz
In Brasilien ist eine gv-Bohne (Pinto-Bohne) mit einer Resistenz gegen das verbreitete Golden Mosaic Virus (BGMV) entwickelt worden. Wissenschaftler des brasilianischen Agrarforschungszentrums Embrapa haben ein Genkonstrukt in die Bohnen eingeführt, so dass diese eine spezielle RNA-Sequenz bilden. Sie bewirkt, dass nach einem Virus-Befall ein für die Vermehrung der Viren notwendiges Gen blockiert wird (RNA‑Interferenz).
Bei Versuchen zeigten die so „immunisierten“ Bohnen eine deutlich verbesserte Resistenz: 93 Prozent der Bohnen wiesen keine der für BGMV-Befall typischen Symptome auf. Nach der Zulassung der gv-Bohne (Embrapa 5.1) durch die brasilianische Kommission für biologische Sicherheit (CTNBio) werden derzeit an mehreren Standorten Anbauversuche mit verschiedenen Bohnensorten durchgeführt, in die zuvor die neue Virusresistenz eingekreuzt worden war.
Die Markteinführung der neuen virusresistenten Bohnen ist 2015/16 vorgesehen. Sie sollen zunächst auf 50.000 Hektar - ein Viertel der von Virusbefall betroffenen Flächen - angebaut werden.
Embrapa arbeitet an Virusresistenzen für weitere in Brasilien populäre Bohnensorten (black bean, carioca bean). - Pilzresistenz
In Mexiko wird an pilzresistenten Bohnen geforscht. 2014 wurde die erste experimentelle Freisetzung genehmigt. - Unkrautmanagement: Herbizidtoleranz
- Hitzetoleranz

Brasilien: Virus vernichtet Bohnenernte. Das Golden Mosaic Virus (BGMV) wird durch die Weißfliege (auch Mottenschildlaus) übertragen und ist eine in Südamerika weit verbreitete Pflanzenkrankheit, die zahlreiche Bohnenarten befällt. Infizierte Pflanzen sind zunächst an gelb gefärbten Blättern zu erkennen, es bilden sich weniger und kleinere Hülsen. Je nach Stärke und Zeitpunkt des Befalls gehen die Ernteerträge zwischen 40 und 100 Prozent zurück. Bis zu 85 Prozent der Bohnenernte in Brasilien sollen Schätzungen zufolge durch das BMGV-Virus vernichtet werden. Die Leidtragenden sind in erster Linie Kleinbauern.
Mit den in Brasilien entwickelten virusresistenten gv-Bohnen
soll die Jahresproduktion um 10 bis 20 Prozent gesteigert
werden. Außerdem hofft man, auf einer wegen des starken
Virusbefalls derzeit nicht nutzbaren Fläche von 200.000
Hektar wieder Bohnen anbauen zu können.
Fotos: Howard F. Schwartz, Colorado State University,
Bugwood.org