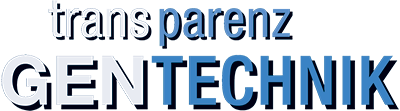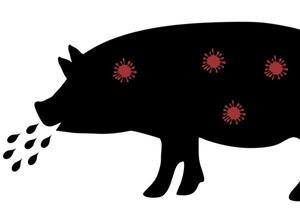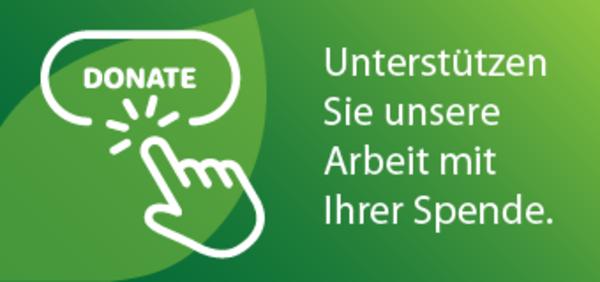Nach dem Verbot des Kükentötens: Optische CRISPR-Biomarker statt komplizierte Tests im Ei
Seit 2022 dürfen „nutzlose“ männliche Eintagsküken nicht mehr getötet werden. Um nur noch weibliche Legehennen aufzuziehen, soll das Geschlecht schon im Ei bestimmt werden. Geeignete Verfahren sind kompliziert und funktionieren erst, wenn die Embryos schon mehrere Tage alt sind. Doch es gibt Alternativen: Ein israelisches Startup hat einen Weg gefunden, die männlichen Eier optisch zu markieren. Direkt nach dem Legen können sie in den Brütereien erkannt und aussortiert werden. Eine schnelle, einfache Lösung – möglich geworden durch die Gen-Schere CRISPR/Cas.

Biomarker mit CRISPR. Anders als bei Säugetieren besitzen bei Hühner (und Vögeln) die männlichen Tiere - die Hähne - zwei gleiche Geschlechtschromosomen (ZZ), die Hennen dagegen zwei unterschiedliche (ZW). Wird bei Hennen ein Gen für ein fluoreszierendes Protein (FP) mit Hilfe von CRISPR in das Z-Chromosom eingeführt, ist das so markierte ZFP-Chromosom nur in männlichen Embryos vorhanden. Die weiblichen Embryos tragen die unveränderten Z- und W-Chromosomen. Nur die „weiblichen Eier“ werden ausgebrütet. Die daraus schlüpfenden Legehennen sind - wie die Eier, die sie legen - nicht gentechnisch verändert.

Eier mit männlichen Embryos leuchten. Die Geschlechtsbestimmung im Ei ist direkt nach dem Legen möglich - ohne Eingriff.
Grafik: Tim Doran, CSIRO: Foto: Video eggXYT; großes Foto oben: 123RF
Noch bis vor wenigen Jahren war es gängige Praxis: Männliche Küken wurden direkt nach dem Schlüpfen getötet, da sie in der Legehennenhaltung nicht zu gebrauchen sind. Sie liefern keine Eier und Fleisch setzen sie kaum an. Um die Hähnchen der Legehuhnrassen so aufzuziehen, dass ihr Fleisch verwertbar ist, braucht man etwa dreimal so lange wie bei Fleischhühnerrassen und um ein Vielfaches mehr Futter.
Allein in Deutschland wurden jährlich rund 45 Millionen Küken getötet, zuletzt überwiegend durch Ersticken mit Kohlendioxid. Seit 2022 ist diese Praxis in Deutschland verboten. In einigen weiteren EU-Ländern wie Frankreich, Österreich und Luxemburg gelten ähnliche nationale Vorgaben. In anderen Ländern ist das Töten der männlichen Küken jedoch weiterhin an der Tagesordnung.
Schon länger suchte die Geflügelbranche nach Alternativen zum Töten der Eintagsküken, das gesellschaftlich immer weniger akzeptiert wurde. Mit vielen Millionen Euro förderten Bundesregierung und Europäische Union die Entwicklung von geeigneten Verfahren, um das Geschlecht der Hühner bereits im Ei bestimmen zu können. Nur die weiblichen Küken werden großgezogen. Inzwischen stehen mehrere technische Verfahren zur Verfügung.
- Beim endokrinologischen Verfahren erfolgt der Geschlechtsnachweis im Ei über spezifische Hormone. Dafür wird am neunten Bebrütungstag mit einem Laserstrahl die Schale des Eis durchstochen und ein Tropfen aus der embryonalen Harnblase (Allantois) entnommen. Bei weiblichen Tieren führt ein Geschlechtshormon zu einer Farbreaktion. Nur solche Eier werden weiter bebrütet. Die aussortierten „männlichen Eier“ werden industriell verwertet, etwa als Tierfutter oder in der Pharmabranche zur Herstellung von Impfstoffen. Dieses Verfahren wurde von REWE und der Universität Leipzig entwickelt, die Eier werden als respeggt-Eier vermarktet.
- Das Geschlecht kann auch über die DNA bestimmt werden. Wie beim endokrinologischen Verfahren wird am neunten Bruttag durch ein winziges Loch im Ei ein Tropfen Harnflüssigkeit entnommen. Die unterschiedliche DNA auf den Geschlechtschromosomen wird mittels PCR nachgewiesen. Das Verfahren (PLANTegg) wird zum Beispiel von ALDI genutzt.
- Kommerziell im Einsatz ist das Hyperspektralverfahren des deutschen Technologieunternehmens Agri Advanced Technologies (AAT). Es funktioniert allerdings nur bei braunen Legehuhnrassen. Bei ihnen unterscheidet sich die Gefiederfärbung der Hähne und Hennen. Die Messtechnik erkennt die unterschiedliche Gefiederfärbung bereits im Ei. Das Verfahren funktioniert durch die intakte Eischale hindurch und erkennt Geschlechtsunterschiede ab dem elften Bebrütungstag. Inzwischen sind mehrere solcher Anlagen in Deutschland, Frankreich und anderen Ländern in Betrieb.
- Bei einem weiteren spektroskopische Verfahren (Omegga) wird mit künstlicher Intelligenz und Lichtmessungen das Geschlecht der Küken nicht-invasiv bereits am sechsten Tag bestimmt. 2024 wurde das System in mehreren Pilotanlangen getestet und soll 2025 auf den Markt kommen.
- Ein weiteres nicht-invasives Verfahren bestimmt das Geschlecht der Embryonen mit Magnetresonanz-Bildern.
Alle derzeit praktisch genutzten Verfahren zur Geschlechtsbestimmung liefern Ergebnisse frühestens am neunten Bruttag. Basierend auf einer aktuellen Studie, nach der davon ausgegangen werden kann, dass die Embryos bis einschließlich zum zwölften Tag kein Schmerzempfinden haben, darf eine Geschlechtsbestimmung im Ei bis zum 13. Bruttag durchgeführt werden.
Vor allem in der Bio-Landwirtschaft setzt man nicht allein auf technische Lösungen. Ein Ausweg ist die Zucht von Zweinutzungshühnern, bei denen sich sowohl die Hähnchen für die Mast eignen als auch die Hennen zum Eierlegen. Noch führt das Zweinutzenhuhn ein Nischendasein, doch die Züchtung neuer Rassen wird weiter vorangetrieben.
Andere Betriebe bleiben weiter bei den Legehuhnrassen, verzichten aber auf das Töten der männlichen Küken und ziehen die Hähnchen trotz der schlechteren und verzögerten Fleischbildung auf. Die Eier verteuert das um etwa drei bis vier Cent. Inzwischen gibt es eine Reihe von Projekten und Unternehmen, die eine solche „Bruder-Aufzucht“ praktizieren und damit werben.
Mit der Gen-Schere CRISPR/Cas: Nur Eier mit männlichen Küken leuchten
Die bisher entwickelten technischen Verfahren zur Geschlechtsbestimmung im Ei sind kompliziert und teuer und liefern erst nach mindestens einer Woche Bebrütung Ergebnisse. Dass es anders geht, zeigen australische und israelische Wissenschaftler: Um das Geschlecht der Hühner-Embryos schon im Ei erkennen zu können, nutzen sie die neuen Möglichkeiten des Genome Editings, um einzelne DNA-Bausteine „umzuschreiben“ oder Gen-Abschnitte gezielt an einer ganz bestimmten Stelle im Genom einzufügen.
Sowohl ein Team um Tim Dolan und Mark Tizard am CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) in Australien als auch EggXYt, ein Startup aus Israel, haben mit Hilfe der Gen-Schere CRISPR/Cas eine DNA-Sequenz für ein fluoreszierendes Protein (RFP) in Legehennen eingeführt – ausschließlich in deren männlichem Geschlechtschromosom. Bei Hühnern haben Hennen zwei verschiedene Geschlechtschromosomen, ein weibliches und ein männliches, die Hähne dagegen zwei gleiche. Werden die genom-editieren Hennen von „normalen“ Hähnen befruchtet, besitzen unter deren Nachkommen alle Hähne das RFP-markierte Chromosom, alle Hennen jedoch die beiden unveränderten Chromosomen (siehe Grafik Kasten oben links).
Damit sind alle männlichen Embryos optisch markiert: Unter UV-Licht sind sie an ihrer fluoreszierenden Farbe direkt nach dem Legen der Eier von weiblichen zu unterscheiden, ohne jeden Eingriff in das Ei. Die männlichen Eier müssen erst gar nicht bebrütet werden. EggXYt will das Verfahren nun in Kooperation mit einem US-amerikanischen Unternehmen international vermarkten. Seine Entwicklung wurde von der EU mit 2,3 Mio Euro gefördert (Horizon 2020).
Inzwischen investiert auch der japanische Eierproduzent Amuse in EggXYt, um in Zukunft ohne Kükentöten auszukommen. CSIRO ist mit dem niederländischen Tierzuchtunternehmen Hendrix Genetics eine Kooperation eingegangen, um die Geschlechtsbestimmung im Ei mit Hilfe von Biomarker-Proteinen für den industriellen Einsatz weiterzuentwickeln.
Noch einen Schritt weiter geht ein staatlich gefördertes Projekt in Israel. Auch dabei wurde mit CRISPR/Cas bei weiblichen Hühnern deren Z-Chromosom so verändert, dass sofort nach dem Legen der Eier nur die männlichen Embryonen in einem frühen Zellstadium absterben. Die Entwicklung soll sich in einem fortgeschrittenen Stadium befinden.
Die CRISPR-basierten Ansätze zur Geschlechtsbestimmung im Ei versprechen, schneller, einfacher und tierfreundlicher zu sein als die derzeit in Deutschland eingesetzten Verfahren. Doch wenn irgendwo „die Gentechnik“ beteiligt sein könnte, regt sich schnell Misstrauen – vor allem in Europa. Dabei sind die verzehrfertigen Eier gentechnisch unverändert, so wie jedes gewöhnliche „natürliche“ Hühnerei.
Zwar wird DNA-Material für den Biomarker in das Erbgut der Mütter der Legehennen eingeführt. Doch nur in den „männlichen Eiern“ ist die Marker-DNA vorhanden. Sie gelten deswegen als „gentechnisch verändert“ und werden nicht im Lebensmittelsektor verwertet. Dagegen enthalten die Eier, aus denen die späteren Legehennen ausgebrütet werden, nur die ursprünglichen Chromosomen und sind frei von „fremdem“ Gen-Material. Sie fallen daher – ebenso wie die Eier, die sie später selbst legen – nicht unter die derzeitigen Gentechnik-Gesetze. Das bestätigte auch die EU-Kommission in einer nicht rechtsverbindlichen Antwort auf eine entsprechende Anfrage des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL).
Doch ob die neuen Konzepte zur Geschlechtsbestimmung mit genom-editierten Biomarkern tatsächlich in Europa zum Einsatz kommen, ist fraglich. Schon schüren gentechnik-kritische Organisationen die Furcht vor „Gentechnik-Eiern“. EggXYt und CSIRO zielen jedoch vor allem auf internationale Märkte. Und die sind groß: Weltweit werden jährlich vier Milliarden männliche Küken getötet.
Diskussion / Kommentare
 Kommentare werden geladen…
Kommentare werden geladen…
Themen
eggXYt: Präsentation des CRISPR-vermittelten Verfahrens zur Identifizierung von männlichen Bruteiern durch sichtbare Biomarker
Im Web
- Hahn oder Henne – Möglichkeiten zur Geschlechtsbestimmung im Ei. Netzwerk Fokus Tierwohl, Mai 2024
- Gene-edited hens may end cull of billions of chicks. BBC, 13.12.2022
- Geschlechtsbestimmung im Brutei ohne Kükentöten. CORDIS - Forschungsergebnisse der EU, 23.09.2022
- eggXYt strategy: Israeli startup launches bid to disrupt the egg industry. Foodnavigator USA, 08.01.2021
- Sex determination techniques for the egg and poultry industries. CSIRO, 24.05.2022
- Doran, T.J. et al. (2017): Sex selection in layer chickens, Animal Production Science 58(3) 476-480, https://doi.org/10.1071/AN16785
- eggXYt
- A novel approach for sexing chicken embryos on day one before incubation - saving them from being hatched and disposed of; CORDIS, Forschungsergebnisse der EU
- Ohne Kükentöten - respeggt
- PLANTegg - In Ovo Geschlechtsbestimmung
- AAT schreibt Geschichte in den USA. AAT 11.12.2024
- Genus Focus for in-ovo sexing. Contactless, modular, and versatile. Orbem
- Wegbereiter nachhaltiger Technologien in der Geflügelhaltung. Omegga
- Ohne Kükentöten: Was macht das Zweinutzungshuhn in der Panzerhalle? top agrar, 19.07.2023
- Stand der Entwicklung von Verfahren und Methoden zur Geschlechtsbestimmung im Hühner-Ei vor dem siebten Bebrütungstag; Bericht des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft an den Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft des Deutschen Bundestages gemäß §21 Absatz 6a des Tierschutzgesetzes; 28.03.2023