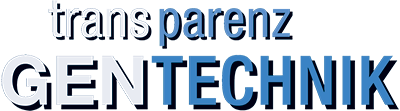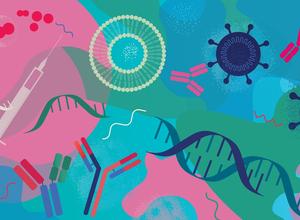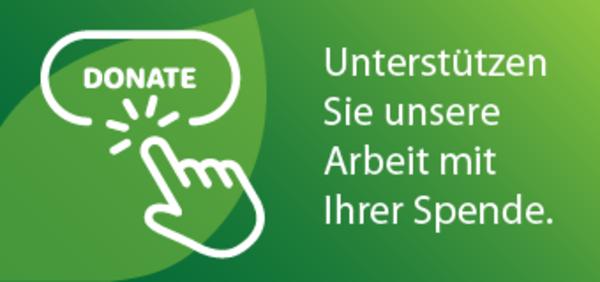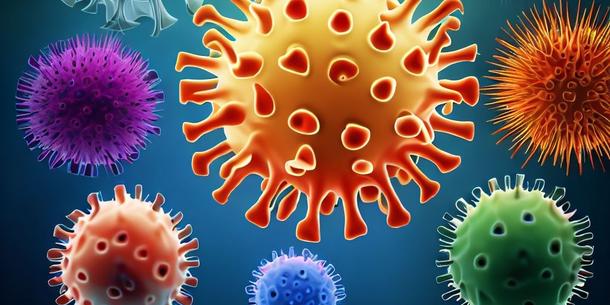
Corona: Wie Virusvarianten entstehen und was sie für die Wirksamkeit von Impfstoffen bedeuten
Von Juliette Irmer
Alpha, Delta, Omikron….BA.1, BA.2, BA.5, XBB1.5, Eris und Pirola… Corona-Virusvarianten sind ein eindrucksvolles Beispiel für Evolution. Die Mutationsgeschwindigkeit von SARS-CoV-2 wirft aber auch Fragen auf: Wie gut und wie lange schützen die Impfstoffe? Wie oft müssen sie angepasst werden? Und gibt es eine Möglichkeit den evolutiven Wettlauf mit dem Virus zu gewinnen?
Viren sind strenggenommen keine Lebewesen, da ihnen ein eigener Stoffwechsel fehlt und sie für ihre Vermehrung zwingend auf eine Wirtszelle angewiesen sind. Entsprechend sind Viren wahre Spezialisten, wenn es darum geht, in Körperzellen einzudringen. Ist ihnen das gelungen, programmieren sie die Zellmaschinerie um, so dass diese fortan massenweise neue Viren produziert: bis zu 10.000 pro Zelle. Die Informationen für diesen Vorgang sind im viralen Erbgut codiert, das bei SARS-CoV-2 aus 30.000 RNA-Nukleotiden besteht, was im Virenreich riesig ist. Zum Vergleich: Bei HIV sind es 10.000 Nukleotide, bei Influenza 14.000. (Das Erbgut des Menschen ist mit 3,2 Milliarden DNA-Nukleotiden 100.000-mal größer.)
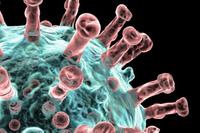
Mutationen im Spike-Protein haben dazu geführt, dass das Corona-Virus leichter in Zellen eindringen kann.
| Variante | Spike Mutationen |
|---|---|
| Delta (war VOC) | 9 |
| Omikron (war VOC) | 30+ |
| Pirola (VOM) | 30+ |
Stand: August 2023 (WHO)
VOC, VOM: WHO-Klassifikation von Virusvarianten (Erläuterungen unten).
Foto: iStock, Grafik oben: BIC (Bing Image Creator)
Am 10. Januar 2020 stellten chinesische Wissenschaftler das erste vollständig entschlüsselte Genom des neuen Coronavirus online. Heute (Stand Oktober 2023) umfasst die GISAID-Datenbank, die Wissenschaftlern rund um den Globus bislang dazu diente, Daten über Influenzaviren zu teilen und zu analysieren, gut 16 Millionen SARS-CoV-2-Sequenzen aus fast allen Ländern.
Das Viren-Erbgut ist nicht nur der Schlüssel für die Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten, sondern dient auch der Kontrolle der Pandemie. Zentral ist dabei das Open-Source-Projekt Nextstrain. Das Projektteam analysiert die Genomsequenzen, erstellt Stammbäume, visualisiert Übertragungsketten und Ausbreitungswege und stellt alles online. Die Plattform CoVariants stellt zudem die Ausbreitung der unterschiedlichen Coronavirus-Varianten in einzelnen Ländern grafisch dar.
Ursache für neu entstehende Virusvarianten sind Mutationen, kleine Veränderungen des Erbguts, die durch das Entschlüsseln der Genome nachverfolgt werden können. Mutationen entstehen zufällig, ständig und in allen Lebensformen. Bei der Vermehrung eines Coronavirus etwa werden die 30.000 RNA-Bausteine tausende Male kopiert. Dabei können Fehler passieren, obwohl Coronaviren, anders als viele andere Viren, einen Reparaturmechanismus besitzen.
Die frisch vermehrten Viren erben einen solchen „Kopierfehler“ und infizieren neue Zellen oder Wirte, wo es im nächsten Vermehrungszyklus wieder zu Mutationen kommen kann. Der Großteil der Mutationen ist bedeutungslos. Ab und an führen sie aber zu neuen Eigenschaften, die sich auf das Infektionsgeschehen auswirken können. Im Falle des Coronavirus etwa Mutationen im Spike-Protein, das dem Virus Zugang ins Zellinnere verschafft. Bieten die neuen Mutationen dem Virus Vorteile, können sie sich durchsetzen.
Im Verlauf der Pandemie war das bereits mehrmals gut zu beobachten: Die Virusvariante Alpha tauchte Ende 2020 erstmals in England auf und dominierte später das Infektionsgeschehen in ganz Europa. Auch anderswo wurden neue Virusvarianten identifiziert, die leichter übertragbar waren. Beta verbreitete sich hauptsächlich in Südafrika, Gamma vor allem in Brasilien und Chile. Die Delta-Variante sorgte im Frühling 2021 für eine verheerende zweite Welle in Indien und verbreitete sich weltweit, bis sie im November 2021 von Omikron abgelöst wurde.
Vor allem die Entstehung von Omikron war durch einen großen evolutiven Sprung gekennzeichnet, also viele Veränderungen im Erbgut von SARS-CoV-2. Experten interpretieren das als Anpassung an den Hauptwirt, den Menschen. Seitdem hat sich SARS-CoV-2 in einen Schwarm von Omikron-Untervarianten aufgesplittert. Für Spannungen sorgten jüngst die Abkömmlinge Eris (EG.5) und vor allem Pirola (BA2.86), weil letztere Variante sich mit gut 30 neue Mutationen genetisch ähnlich stark von Omikron unterscheidet wie Omikron damals von Delta.
Tatsächlich ist es für das Coronavirus im vierten Jahr der Pandemie nicht mehr so einfach Wirte zu finden, in denen es sich bequem vermehren kann. Denn es trifft nicht mehr auf eine immunologisch naive Bevölkerung, sondern auf Milliarden Menschen, deren Immunität durch Impfungen, natürliche Infektionen oder einer Kombination aus beidem gestärkt ist. Das Virus steht daher unter einem starken Selektionsdruck, das heißt, gut vermehren können sich nur jene Viren, die sich der aufgebauten Körperabwehr durch Immunflucht-Mutationen entziehen. Diese führen dazu, dass Antikörper, die nach einer Impfung oder Infektion gebildet wurden, die neuen Virusvarianten weniger gut erkennen und unschädlich machen können.
Die Evolution von SARS-CoV-2 wirft zwangsläufig die Frage auf, wie lange die entwickelten Impfstoffe wirksam sind und wie gut sie gegen Varianten schützen. Dabei muss zwischen dem Schutz vor Infektion und dem Schutz vor einem schweren Verlauf unterschieden werden. Gegen Alpha haben die Impfstoffe verlässlich sowohl vor einer Infektion, als auch einem schweren Verlauf geschützt. Bei Delta war der Schutz vor einer Infektion geringer und nahm mit der Zeit immer weiter ab. Bei allen Omikron-Abkömmlingen ist der Schutz vor einer Infektion deutlich reduziert, das heißt, auch Geimpfte und Genesene können sich neu anstecken. Bisher hat es aber keine SARS-CoV-2-Variante geschafft, der Immunabwehr vollständig zu entgehen. Entscheidend dafür ist auch die durch T-Zellen vermittelte Immunität: Sie zielt auf antigene Virusstrukturen ab, die gut konserviert sind, also nicht oder kaum mutieren. So sind die meisten Menschen heute vor einem schweren Verlauf geschützt.
Besonders gefährdeten Personen, also Älteren und Vorerkrankten, deren Immunität mit der Zeit nachlassen kann, rät die STIKO (Ständige Impfkommission) aber zu Auffrischungsimpfungen. Aktuell mit dem an die XBB.1.5-Variante angepassten Impfstoff von Biontech/Pfizer oder Moderna. Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass er auch gegen die Eris- und Pirola-Variante wirksam ist. (Eine tabellarische Übersicht der Stiko-Impfempfehlung findet sich auf Seite 4 und 5 des Epidemiologischen Bulletin 21/2023, siehe Im Web)
Als problematisch könnte sich auch die Fähigkeit von SARS-CoV-2 erweisen, die Artgrenze zu überspringen: Bislang wurden der Weltorganisation für Tiergesundheit Übertragungen in 29 unterschiedlichen Tierarten gemeldet. Möglicherweise könnten so weitere Reservoire für das Virus entstehen. Rückübertragungen in den Menschen wurden bereits aus Nerzen und Hamstern nachgewiesen, wie häufig und wie leicht dies geschieht, ist unklar.
Die Entwicklungen unterstreichen die Notwendigkeit einer kontinuierlichen genomischen Überwachung von SARS-CoV-2, auch um die Impfstoffe anzupassen, falls nötig. Zwar lassen sich gerade die mRNA-Impfstoffe relativ einfach aktualisieren, dennoch hinkt man auch mit dieser flexiblen Technologie dem Virus häufig hinterher. Geforscht wird daher an Impfstoffen, die auch eine Infektion verlässlich verhindern können.
Klassifikation der Virusvarianten
Im Mai 2021 hatte die WHO eine neue Klassifikation und Nomenklatur für Virusvarianten vorgestellt: Die Varianten werden nach den Buchstaben des griechischen Alphabets benannt und in drei Kategorien eingeteilt. Eine besorgniserregende Variante, Variant of Concern (VOC), ist danach ansteckender, verursacht schwere Erkrankungen und/oder verringert die Wirksamkeit von Impfstoffen. Eine Variant of Interest (VOI) ist eine Virusvariante, mit genetischen Veränderungen, die auf ein neu auftretendes Risiko für die globale öffentliche Gesundheit hindeuten. Eine Variant under Monitoring (VUM) steht unter Beobachtung.
Im Oktober 2022 hat die WHO ihrem Varianten-Klassifikationssystem eine neue Kategorie hinzugefügt: Omicron subvariants under monitoring.
Omikron, als VOC klassifiziert, dominiert das Infektionsgeschehen weltweit, hat sich aber in der Zwischenzeit stark aufgesplittet, das heißt, es existiert ein ganzer Schwarm Omikron-Untervarianten. Die neue Einteilung soll dabei helfen, den Überblick über potentiell besorgniserregenden Omikron-Nachkommen zu behalten.
Diskussion / Kommentare
 Kommentare werden geladen…
Kommentare werden geladen…
Themen
Werden die Mutanten alles ruinieren? Impfstoffe, Fluchtviren und T-Zellen als Hoffnungsträger. (Martin Moder, #EUMythBusters)
Im Web
- CoVariants, Overview of Variants/Mutations
- Nextstrain, Sars-CoV-2 resources page
- WHO, Tracking SARS-CoV-2 variants
- Will COVID-19 boosters protect against new variants such as “Pirola” and “Eris”? Lind Geddes, Sept 2023 (Gavi)
- Evolution and neutralization escape of the SARS-CoV-2 BA.2.86 subvariant; Preprint
- Science Media Center (SMC); Nutzen angepasster Corona-Impfstoffe bei immer neuen Virusvarianten (13.06.2022)
- ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), SARS-CoV-2 variants of concern
- Corona-Impfstoffe der nächsten Generation, vfa
- STIKO-Empfehlung zur COVID19-Impfung. RKI, Epidemiologisches Bulletin 21/2023
- SARS CoV-2 in Animals – Situation Report 22 (Jun 2023